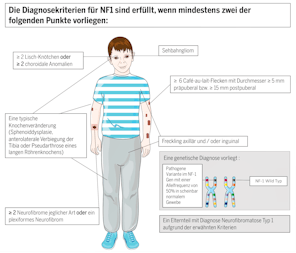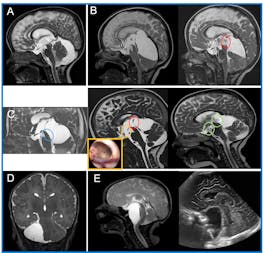In pädiatrischen Notfallstationen sind neuropädiatrische Notfälle mit > 5% der Konsultationen vertreten: Der häufigste Grund ist der epileptische Anfall, gefolgt von anderen, teils deutlich selteneren Krankheitsbildern. Viele neuropädiatrische Notfälle wie Kinder mit Fieberkrämpfen und Kopfschmerzen zeigen einen «gutartigen» Verlauf. Andererseits gilt es seltene, potentiell lebensbedrohliche zu erkennen. Der klinischen Beurteilung kommt dabei die wichtigste Bedeutung zu, da die klinische Synthese eine neurologische Lokalisationsdiagnostik und den richtigen Einsatz der technischen Hilfsmittel erlaubt. Insbesondere sind fokalen Hinweisen in der Anamnese und im Neurostatus Beachtung zu schenken, da sie mehrheitlich auf eine relevante Ursache hinweisen können.
Neuropädiatrische Notfälle