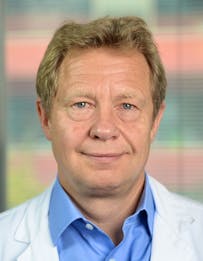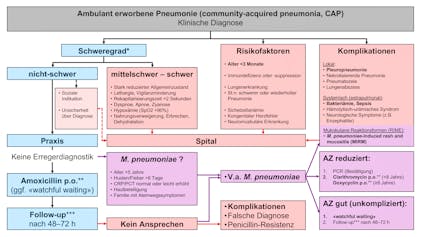Die Schwierigkeiten bei der Behandlung eines Keuchhustens kommen daher, dass Antibiotika nur während des oft symptomarmen katarrhalen Stadiums wirksam sind. Treten erst die typischen Hustenanfälle auf, beeinflusst die antibiotische Behandlung die Krankheit selbst kaum mehr. Sie wird aber dennoch empfohlen, um die Übertragungswahrscheinlichkeit der Bakterien auf gefährdete Personen zu reduzieren und Keuchhustenausbrüche einzugrenzen. Im Stadium decrementi wird die antibiotische Behandlung nicht mehr empfohlen, auch wenn der Patient noch hustet. Ohne antibiotische Behandlung wird die Dauer der Kontagiosität auf 21 Tage ab Hustenbeginn geschätzt, ausser beim Säugling, wo sie länger dauern kann. Durch die antibiotische Behandlung kann die Ansteckungsgefahr auf 5 Tage ab Behandlungsbeginn reduziert werden. Es kann gelegentlich unter speziellen Umständen (später, möglicher Kontakt mit einer gefährdeten Person oder im Spital) notwendig sein, am Ende der antibiotischen Behandlung die Eli
minierung der Bakterien aus dem Nasenrachensekret mittels negativer PCR zu belegen. Die antibiotische Behandlung wird in der Tabelle zusammengefasst. Zu beachten ist, dass Clarithromycin in der Schweiz gemäss Swissmedic ab dem Alter von 6 Monaten zugelassen ist; das Bundesamt für Gesundheit (BAG) empfiehlt es jedoch im Zusammenhang mit Keuchhusten ab 1 Monat. Die Behandlungsdauer wurde ausführlich untersucht und in einer Metaanalyse durchgesehen. Aktuelle Empfehlungen ziehen Kurzbehandlungen mit Azithromyzin während 5 Tagen vor, um Complianceprobleme und Nebenwirkungen möglichst gering zu halten. Es werden noch kürzer dauernde Behandlungen mit Azithromyzin während 3 Tagen angewandt, jedoch ist die derzeit verfügbare Evidenz zur Wirksamkeit ungenügend, um diesen verkürzten Behandlungsmodus in offizielle Empfehlungen aufzunehmen.
Empfehlungen zur Behandlung von Pertussis und Strategien zur Verhinderung von Ausbrüchen