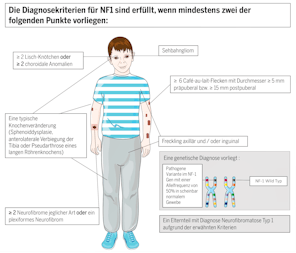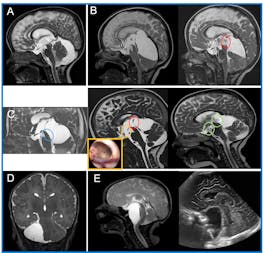In der Schweiz lebten gemäss Bundesamt für Statistik 2013 rund 21’000 Kinder mit schweren und ca. 132‘000 Kinder mit leichteren Behinderungen1. Die Betreuung dieser Kinder und Jugendlichen bedeutet eine grosse Herausforderung für die Familien, die involvierten Therapeuten, das Schulsystem und die betreuenden Kinderärzte. Als eine verbindliche sozial-rechtliche Grundlage – insbesondere für Integrationsmassnahmen – trat 2014 auch in der Schweiz die UN-Menschenrechtskonvention für Menschen mit Behinderungen (Behindertenrechtskonvention, BRK) in Kraft. Auf www.institut-fuer-menschenrechte.de findet sich eine zwischen Deutschland, Liechtenstein, Österreich und der Schweiz abgestimmte Übersetzung des Vertragstextes der BRK.2 Die von der WHO entwickelte Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF), seit 2007 auch als Kinder- und Jugendversion vorliegend, kann eine grundsätzliche Hilfestellung anbieten, sich in den verschiedenen Aspekten der Betreuung zurecht zu finden3. Die ICF zeigt auf, dass Struktur und Funktion von Organsystemen zwar wichtige Grundlagen darstellen, aber Ziele und Wünsche von Patienten häufig in den Aktivitäten und Partizipationsmöglichkeiten angesiedelt sind. So ist z. B. das Erreichen einiger verbesserten Grade in der passiven Gelenksbeweglichkeit (pROM) für das Kind vielleicht weniger wichtig, als an der Schulreise teilnehmen zu können. Die Kontext und persönlichen Faktoren eines Patienten müssen immer in die Planung von (Re)habilitationsmassnahmen einbezogen werden. Der Wohnort eines Patienten spielt gerade in der föderal organisierten Schweiz eine wichtige Rolle, da die Angebote und deren organisatorischen Abläufe regional oft sehr unterschiedlich sind.
Aspekte der kinderärztlichen Betreuung von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen