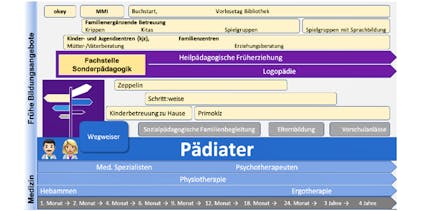Einleitung
Jede vierte Konsultation in einer pädiatrischen Praxis ist eine Vorsorgeuntersuchung. Diese Untersuchungen dienen der Früherkennung von Krankheiten und Entwicklungsproblemen und der antizipierenden Beratung der Eltern in Entwicklungs- und Erziehungsfragen 1). Im Zentrum einer Vorsorgeuntersuchung steht vor allem das Screening der körperlichen, motorischen, kognitiven, sprachlichen und sozialen Entwicklung eines Kindes.
Schwerwiegende Entwicklungsstörungen werden in den Vorsorgeuntersuchungen meist zuverlässig erkannt. Leichtere Auffälligkeiten lassen sich aber oft erst dann erfassen, wenn beim Kind entsprechende Fähigkeiten, beispielsweise der Sprache, Kognition oder des Sozialverhaltens entwickelt sind. So kann zum Beispiel bei Kindern mit milden kognitiven Defiziten zuerst eine verzögerte Sprachentwicklung auffallen, die vorab eine logopädische Behandlung indiziert und es werden erst später andere Fördermassnahmen eingeleitet.
Viele Kinder mit leichten Entwicklungsauffälligkeiten stammen aus Familien mit psychosozialen Risiken 2). Das Konzept von Risiko- und Schutzfaktoren könnte deshalb im Rahmen der Vorsorgeuntersuchungen in der Praxis zunehmend wichtig werden. Angestossen durch die Longitudinalstudie der Entwicklungspsychologin Emmy Werner bei Kindern auf der Hawaiiinsel Kauai 3) und durch das Salutogenese Konzept des Soziologen Aaron Antonowsky 4) liegt heute der Fokus bei der Suche nach Ursachen und Bedingungen von Entwicklungs- und Verhaltensstörungen nicht mehr ausschliesslich auf den Risikofaktoren, sondern vermehrt auch auf der Identifizierung von Schutzfaktoren. Dieser Artikel fasst das aktuelle Wissen rund um Risiko- und Schutzfaktoren für die kindliche Entwicklung zusammen und gewichtet diese anhand von drei Fallbeispielen.
Risikofaktoren
Eine Reihe von Risikofaktoren führen dazu, dass Entwicklungs- und Verhaltensstörungen entstehen oder verstärkt werden. Es werden dabei zwei verschiedene Gruppen von Risikofaktoren unterschieden (Tabelle 1):
- Kind-bezogene Faktoren, welche biologische und psychologische Merkmale des Kindes umfassen wie zum Beispiel chronische Krankheiten, Entwicklungsstörungen oder ein schwieriges Temperament.
- Faktoren, die in der psychosozialen Umwelt des Kindes liegen, beispielsweise ein belastendes Elternhaus oder negative Schulerfahrungen.
Folgende Merkmale erhöhen die Wahrscheinlichkeit, dass ein Risikofaktor zu einer Störung führt.
Schweregrad des Risikofaktors: Je schwerer die Ausprägung eines Risikofaktors, desto grösser ist die Gefahr für eine dauernde Störung. Beispiel: Kinder mit einer schweren kognitiven Einschränkung (mit einem Intelligenzquotienten IQ < 50) werden als Erwachsene nicht selbstständig leben können, während viele Kinder mit einem IQ zwischen 60 und 80 (zumindest teilweise) eine Selbständigkeit erlangen 5).
Anhäufung von Risikofaktoren: Selten ist nur ein einzelner Risikofaktor für das Entstehen einer Entwicklungsstörung verantwortlich, sondern erst wenn mehrerer Belastungen zusammentreffen, erhöht sich das Risiko für eine abnorme Entwicklung. Beispiel: Die Wahrscheinlichkeit für eine Entwicklungsstörung bei einem extrem frühgeborenen Kind ist höher, wenn das Kind gleichzeitig ein schwieriges Temperament hat, eine Hirnläsion zeigt und ein Elternteil unter einer psychischen Krankheit leidet.
Dauer der Belastung: Je länger eine Belastung andauert, desto grösser ist das Risiko für eine persistierende Störung. Beispiel: Ein andauernd tiefer sozioökonomischer Status der Eltern führt eher zu bleibenden Entwicklungs- und Verhaltensstörungen im Kindesalter als eine vorübergehende elterliche Krisensituation 6).
Geschlecht: Knaben sind wesentlich häufiger von Entwicklungsstörungen betroffen als Mädchen 7) und auch die Häufigkeit von chronischen Erkrankungen im Kindesalter ist beim männlichen Geschlecht erhöht. Eine mögliche Erklärung liegt bei häufigen X-chromosomalen Erbgängen von Entwicklungsstörungen und Erkrankungen. Im Verlauf der Pubertät nimmt die Anfälligkeit besonders von psychischen Erkrankungen bei Mädchen allerdings zu.

Übersicht über Risiko- und Schutzfaktoren für die kindliche Entwicklung
Schutzfaktoren
In der Literatur wird intensiv darüber diskutiert, was ein Schutzfaktor der kindlichen Entwicklung überhaupt ist (z.B. Seite 29 in 8)). Grundsätzlich sind Schutzfaktoren besondere Merkmale, welche die Entstehung einer Entwicklungs- oder Verhaltensstörung verhindern oder vermindern und eine positive Entwicklung begünstigen (siehe dazu die bahnbrechende Arbeit von Michael Rutter im Jahr 1987 9)). Nicht jeder Schutzfaktor führt allerdings zu einer Verminderung eines Risikos, denn Schutzfaktoren können in verschiedenen Situationen unterschiedlich wirken. So können gute kognitive Fähigkeiten eines Kindes einerseits dazu beitragen, gewisse Risiken auszugleichen, andererseits können sie aber aufgrund einer differenzierteren Sicht auf die Umwelt auch zu vermehrtem Stress führen. Auch bei den Schutzfaktoren gilt: Je mehr Schutzfaktoren vorhanden sind, desto kleiner ist das Risiko für Entwicklungsauffälligkeiten. Im klinischen Alltag sind Schutzfaktoren besonders wichtig, weil diese durch eine Förderung unterstützt werden können. Es ist einfacher, Schutzfaktoren zu verstärken als Risikofaktoren auszugleichen. Beispielsweise kann mit einer psychologischen Beratung die Eltern-Kind-Beziehung positiv beeinflusst werden.
Es gibt Hinweise, dass nicht alle Schutzfaktoren gleichermassen wirken (Hierarchisierung der Schutzfaktoren 10)). Im Folgenden werden exemplarisch einige wichtige Schutzfaktoren erwähnt, die empirisch gut untersucht sind.
Kognitive Fähigkeiten: Viele Studien konnten zeigen, dass Kinder mit Fähigkeiten Probleme zu lösen und mit kognitiven und schulischen Stärken negative Erfahrungen deutlich besser kompensieren können als solche, die nicht über diese Eigenschaften verfügen 3, 11).
Positives Temperament und Selbstregulation: Bereits in der Kauai Longitudinalstudie fanden Werner und Kollegen 3), dass diejenigen Kinder einen guten Verlauf zeigen, die emotional ausgeglichener und anpassungsfähiger sind. Viele weitere Untersuchungen haben bestätigt, dass Kinder mit einem „pflegeleichten“ Temperament positive Reaktionen wie Zuwendung, Wärme und Unterstützung bei den Bezugspersonen hervorrufen 12). Ein positives Temperament ist auch mit guten Fähigkeiten zur Selbstregulation assoziiert, einem wichtigen Schutzfaktor der kindlichen Entwicklung 13). Die Selbstregulation umfasst die Fähigkeit Impulse, Gefühle und Emotionen zu regulieren und exekutive Funktionen zu aktivieren (z. B. planen, überwachen und steuern).
Selbstwirksamkeit und Selbstwertgefühl: Selbstwirksamkeit beschreibt das Gefühl eines Kindes durch eigenes, aktives Handeln etwas bewirken zu können, das zu einem Ziel und einer positiven Veränderung führt. Kinder entwickeln Selbstwirksamkeit durch Experimentieren, durch Erkennen der Konsequenzen ihrer Handlungen und durch die Rückmeldung der Umwelt. Erst eine ausreichende Selbstwirksamkeit führt dazu, dass das Kind Vertrauen gewinnt etwas zu riskieren und zu verändern. Durch erfolgreiche Bewältigung von schwierigen und neuen Situationen gewinnt das Kind an Selbstwertgefühl 14).
Geborgenheit: Viele Studien konnten zeigen, dass psychisch stabile und verfügbare Bezugspersonen, die Vertrauen, Nähe und Sicherheit fördern, sowie die Qualität der Beziehung zwischen der Bezugsperson (meistens der Eltern) und dem Kind die wohl wichtigsten Schutzfaktoren sind (z. B. 11). Einfühlsames Verhalten der Bezugspersonen führt zu einem Gefühl der Geborgenheit bei den Kindern. Der Begriff „Geborgenheit“ fasst den Zustand der Vertrautheit und Sicherheit gut zusammen. Tatsächlich wurde das Wort „Geborgenheit“ vom Deutschen Sprachrat und Goethe Institut im Jahre 2004 als zweitschönstes deutsches Wort bezeichnet. Es gibt wahrscheinlich in keiner anderen Sprache ein entsprechendes Wort, das diesen wichtigen Schutzfaktor so passend beschreibt.
Autoritatives Erziehungsklima: In der Literatur werden verschiedene Erziehungsstile definiert: autoritativer Stil (hohe Wärme und hohe Kontrolle), autoritärer Stil (niedrige Wärme und hohe Kontrolle), permissiver Stil (hohe Wärme und niedrige Kontrolle) und vernachlässigender Stil (niedrige Wärme und niedrige Kontrolle). Mehrfach haben Studien bestätigt, dass ein autoritativer Stil einen wichtigen Schutzfaktor darstellt 3). Dieser Erziehungsstil ist mit Wärme, Wertschätzung und Akzeptanz gegenüber dem Kind und gleichzeitig hohem Mass an Führung und Monitoring assoziiert.
Wenn keine Schutzfaktoren vorliegen, dann können die vorhandenen Risikofaktoren eine Störung begünstigen. Das Fehlen jeglicher Risikofaktoren heisst allerdings nicht, dass ein Individuum vor Störungen geschützt ist. Mit anderen Worten: Risikofaktoren sind nicht einfach das Gegenteil von Schutzfaktoren und umgekehrt. Die Beiden beeinflussen sich in einem komplexen Wechselspiel.
Wechselwirkung von Risiko- und Schutzfaktoren
Kinder mit Risikofaktoren haben im Vergleich zu Kindern ohne solche ein statistisch erhöhtes Risiko für Entwicklungsstörungen. Nicht jeder Risikofaktor stellt aber per se eine Entwicklungsgefährdung dar. Kommt es hingegen zu einer Häufung von Risikofaktoren bei gleichzeitigem Fehlen von Schutzfaktoren, kann sich dies negativ auf die Entwicklung des Kindes auswirken. Dies bedeutet, dass ein Schutzfaktor besonders dann wirksam ist, wenn Risiken vorhanden sind. Sie „puffern“ die Belastungen sozusagen ab. Wächst ein Kind in normalen, unbelasteten Verhältnissen auf, so wird die Entwicklung durch eine Vielzahl von unterschiedlichen Bedingungen gefördert und wird nicht durch einen einzelnen Schutzfaktor geprägt. In diesen Fällen wird ein Kind in der Regel ein gutes Wohlbefinden und Selbstwertgefühl entwickeln und sein anlagebedingtes Potential erreichen.
Bei fehlenden Schutzfaktoren können die risikoerhöhenden Umstände unmoduliert zum Tragen kommen. Beim Vorhandensein eines protektiven Faktors hingegen werden die entwicklungshemmenden Einflüsse des Risikos gemildert oder sogar ganz verhindert. Die Ansicht, dass sich Risiko- und Schutzfaktoren in einer einfachen Rechnung aufsummieren lassen, ist allerdings falsch. Es handelt sich vielmehr um eine komplexe Wechselwirkung, in der Schutzfaktoren abhängig vom Kontext, den spezifischen Umständen und der individuellen Sensitivität von Individuen gegenüber Umwelteinflüssen wirken.
Fallvignetten
Die drei Fallvignetten stammen aus einer retrospektiven Fallstudie von ehemaligen Schülern der sonderpädagogisch-therapeutischen Tagesschule (SPTT) des Kinderspitals Zürich. Die Studie wurde von der kantonalen Ethik-Kommission begutachtet und genehmigt und die ehemaligen Schüler der SPTT gaben ihr schriftliches Einverständnis zur Teilnahme an der Fallstudie. Die SPTT beschulte bis 2013 Kinder vom Kindergarten bis zur Primarschulunterstufe, die im Kanton Zürich in keiner anderen Schule unterrichtet werden konnten. Die Kinder litten unter schwerwiegenden psychosozialen Belastungssituationen sowie emotionalen und/oder sozialen Störungen. Einige qualifizierten für eine spezifische Diagnose wie Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung (ADHS) oder Autismus Spektrum Störung. Keines der Kinder litt unter einer kognitiven oder neurologischen Beeinträchtigung. Durch eine sehr kleine Klassengrösse von maximal vier Kindern konnte eine beinahe 1:1 Betreuung angeboten werden. In der retrospektiven Fallstudie wurden 26 heute erwachsene Personen befragt.
Christian (Name geändert)
Christian hatte seit der Geburt bis in das junge Erwachsenenalter nie wirklich Geborgenheit erlebt. Seine Mutter hatte schwerwiegende Suchtprobleme, dabei viele Klinikaufenthalte zum stationären Entzug aber auch mehrerer Rückfälle, praktisch während Christians gesamter Kindheit. Die Eltern trennten sich als er nur wenige Monate alt war. Stabile und verfügbare Bezugspersonen gab es nicht. Christian war ein irritabler Säugling und zeigte als Kleinkind schwere Trotzanfälle. Er erlebte immer wieder häusliche Gewalt. In der Kinderkrippe und im Kindergarten ging es recht gut, wenn jeweils eine Betreuungsperson nur für ihn da war. Wegen hohem Betreuungsaufwand wurde er in der Folge in die SPTT eingeschult. Zur gleichen Zeit wurde er wegen der stationären Aufenthalte seiner Mutter in ein Kinderheim eingewiesen. Der Kontakt zur Mutter brach ab. In der Schule war er stark verhaltensauffällig. Abklärungen zeigten eine durchschnittliche Grundintelligenz, aber erhebliche Problemen beim Erlernen der Kulturtechniken Lesen und Schreiben. Er wurde von den Lehrpersonen allerdings auch als phantasievolles und neugieriges Kind beschrieben. Christian schilderte das Schulheim als extrem streng. Nach Abschluss der Sekundarschule Niveau C begann er in einem Lehrlingsheim eine Ausbildung mit eidgenössischem Berufsattest. Auch während dieser Zeit zeigte er schwerwiegende Verhaltensstörungen mit Ausrastern, Fernbleiben von der Arbeit und Lügen obwohl die Beziehung zum Lehrmeister gut war und er über ausreichende Fähigkeiten zur Bewältigung der Anforderungen verfügte. Das Lehrverhältnis wurde noch während der Lehrzeit abgebrochen. Im Verlauf sollte er in einer Wohnschule zur Selbstständigkeit geführt werden. Mit grosser Begeisterung und guten Vorsätzen, es diesmal zu schaffen, begann er erneut eine Lehre. Allerdings verübte er abermals gefährliche Streiche und hielt sich nicht an die Abmachungen, so dass ihm auch dieser Lehrmeister kündigen musste. Es folgte eine betreute psychiatrische Wohngemeinschaft. Heute bezieht Christian eine IV-Rente und geht keiner Arbeit nach, weil gemäss eigenen Aussagen der Lohn nicht höher wäre als seine Rente. Er lebt in einer kleinen Einzimmerwohnung und ist nach wie vor enttäuscht, dass seine Mutter keinen Kontakt zu ihm möchte (Tabelle 2).
Interpretation: Christian litt unter einer Kumulation von schwerwiegenden Risikofaktoren ohne wesentliche Schutzfaktoren. Er erlebte ungenügende Geborgenheit in seiner Kindheit. Man kann ausserdem davon ausgehen, dass sein schwieriges Temperament oft auch negative Reaktionen wie Ablehnung, Bestrafung und Distanzierung von Bezugspersonen auslöste.

Felice (Name geändert)
Felice wuchs in einem sehr behüteten Umfeld auf. Im Interview als 20jähriger junger Erwachsener sagt er spontan, dass er die besten Eltern der Welt gehabt hätte. Das Wichtigste sei gewesen, dass ihm seine Eltern viel Zeit geschenkt hätten. Der gute Familienzusammenhalt bestehe bis heute noch. Beide Eltern haben eine KV-Ausbildung gemacht, der Vater war Abteilungsleiter in einer Firma, die Mutter Hausfrau. Eine jüngere Schwester ist Fachfrau Gesundheit. Schwangerschaft und Geburt waren unauffällig. Felice zeigte eine schwerwiegende Spracherwerbsstörung. Er konnte bis in den Kindergarten nicht sprechen und verstand seine Umgebung nicht. Abklärungen bestätigten die schwere Sprachstörung mit Teilleistungsstörungen bezüglich auditiver und visueller Merkfähigkeit bei altersentsprechender Grundintelligenz. Felice war ein sehr zugewandter und freundlicher Knabe, der trotz seiner schwerwiegenden Entwicklungsstörung ein gutes Selbstwertgefühl entwickelt hatte. Während der Kindergarten- und Schulzeit in der SPTT erhielt er intensive Logopädie. Die Reintegration in die Regelschule gestaltete sich allerdings sehr schwierig. Er wurde gehänselt und gemobbt, von der Gemeinschaft ausgeschlossen und entwickelte schwere Verhaltensstörungen. Trotzdem schaffte er einen regulären Sekundarschulabschluss Niveau B mit Noten zwischen 4 und 5. Eine begonnene Lehre als Elektroniker brach er nach einem Jahr ab und begann sich eigenständig mit der Finanzbranche zu beschäftigen. Heute wirkt er als erfolgreicher Berater im Mikrowährungsbereich. Er hat sich in der Zwischenzeit als freundlicher und zugewandter junger Mann entwickelt, der recht gut spricht und kommunikativ ist (Tabelle 3).
Interpretation: Im Gegensatz zu Christian konnte Felice auf eine Reihe von Kind- und Umwelt-bezogenen Schutzfaktoren zurückgreifen, die seine Risikofaktoren wie die schwere Sprachstörung und die negativen Schulerfahrungen kompensierten.

Nelson (Name geändert)
Nelson hatte einen schweren Start ins Leben. Dank seines freundlichen Charakters, seiner guten Intelligenz und der Tatsache, dass er im Leben meist wohlgesonnenen, häufig fachlich kompetenten und sich oft für längere Zeit für ihn verantwortlich fühlende Bezugspersonen begegnet ist, war sein Lebensverlauf erstaunlich positiv. Nelsons Mutter wuchs in sehr einfachen Verhältnissen auf. Mit zwei Töchtern zog sie vor einigen Jahren in die Schweiz, wo sie einen Schweizer heiratete. Schwangerschaft und Geburt von Nelson waren unauffällig. Die Ehe wurde allerdings bald geschieden und die Eltern trennten sich. Nelson erinnert sich nicht an seinen Vater. Schon früh war er in der Kita wegen Entwicklungsverzögerung aufgefallen und erhielt heilpädagogische Früherziehung. Im Alter von vier Jahren erfolgte die Einweisung in ein Kinderheim, weil seine Mutter die Sorge für Nelson nicht mehr gewährleisten konnte. Sie war arbeitslos, Sozialhilfeempfängerin und lebte in grosser Armut. Er selber sagt heute, dass sie nicht mehr in der Lage gewesen sei, zu ihm zu schauen. Im Kinderheim betreute ihn während drei Jahren ein kompetenter, verfügbarer und feinfühliger Heilpädagoge als enge Bezugsperson. In der SPTT zeigten sich anfänglich Verhaltensauffälligkeiten und Schwierigkeiten in der Integration. Die enge Betreuung in der Schule und im Kinderheim führte aber im Verlauf zu einer Stabilisierung der Situation. Rasch erlernte er die Kulturtechniken und entwickelte ein gutes Selbstwertgefühl. Er schloss die Oberstufe in einer regulären Sekundarschule Niveau B ab. Eine anspruchsvolle Lehre bestand er mit sehr guten Noten. Heute wirkt er in seiner Freizeit als Gruppenführer in der Pfadi und er liest sehr gerne, besonders wissenschaftlich Magazine. Er hat eine Arbeitsstelle in seinem Lehrbetrieb, denkt an eine Berufsmaturität, träumt von einem Studium und einer eigenen Familie (Tabelle 4).
Interpretation: Verfügbare und feinfühlige Bezugspersonen müssen nicht unbedingt die Eltern sein, sondern auch andere Personen können dem Kind die nötige Geborgenheit geben. Im Fall von Nelson konnte eine mehrjährige stabile Betreuungssituation in einem Kinderheim mit kompetenten Fachpersonen die Belastungen zu Beginn des Lebens kompensieren. Dieses Fallbeispiel zeigt, dass Geborgenheit nicht nur im Kleinkindalter, sondern auch im späteren Leben wichtig ist.

Fazit
Die Interviews mit den ehemaligen Schülern der SPTT zeigten, dass eine ausreichende Geborgenheit mit psychisch stabilen, verfügbaren, verlässlichen und feinfühligen Bezugspersonen der wohl wichtigste Schutzfaktor für die langfristige Entwicklung von Kindern mit schwerwiegenden Risiken ist. Wir konnten in dieser Untersuchung bestätigen, dass nicht alle Schutzfaktoren ihre Wirkung gleichermassen ausüben (Hierarchisierung der Schutzfaktoren 10)), sondern dass die Umwelt-bezogenen Schutzfaktoren besonders wichtig sind. Eine Elternberatung und –unterstützung ist aus diesem Grund entscheidend. Die kinderärztlichen Vorsorgeuntersuchungen sind eine Chance nicht nur Risikofaktoren für Entwicklungsstörungen zu erfassen, sondern auch Schutzfaktoren beim Kind und seiner Familie zu identifizieren und entsprechende Massnahmen einzuleiten.
Referenzen
- Jenni OG, Sennhauser FH. Child Health Care in Switzerland. J Pediatr. 2016; 177S:S203-S12.
- Durkin MS, Yeargin-Allsopp M. Socioeconomic Status and Pediatric Neurologic Disorders: Current Evidence. Semin Pediatr Neurol. 2018; 27:16-25.
- Werner EE, Smith RS. Vulnerable but invicible. A longitudinal study of resilient children and youth. New York: McGraw-Hill; 1982.
- Antonovsky A. Salutogenese. Tübingen: DGVT Verlag; 1997.
- Huang P, Blum NJ. Developmental and behavioral disorders grown-up-intellectual disability. J Dev Behav Pediatr. 2010; 31:61-71.
- Bradley RH, Corwyn RF. Socioeconomic status and child development. Annu Rev Psychol. 2002; 53:371-99.
- Richardson SA, Koller H, Katz M. Factors Leading To Differences In The School Performance Of Boys And Girls. Journal of Developmental and Behavioral Pediatrics. 1986; 7:49-55.
- Fröhlich-Gildhoff K, Rönnau-Böse M. Resilienz. 4. Auflage ed. München: Ernst Reinhardt Verlag; 2015.
- Rutter M. Psychosocial resilience and protective mechanisms. Am J Orthopsychiatry. 1987; 57:316-31.
- Zander M. Armes Kind – starkes Kind? 2. Auflage ed. Heidelberg: Springer Verlag; 2009.
- Masten AS, Coatsworth JD. The development of competence in favorable and unfavorable environments – Lessons from research on successful children. American Psychologist. 1998; 53:205-20.
- Wustmann C. Die Blickrichtung der neueren Resilienzforschung. Wie Kinder Lebensbelastungen bewältigen. Zeitschrift für Pädagogik. 2005; 51:192–206.
- Eisenberg N, Valiente C, Morris AS, Fabes RA, Cumberland A, Reiser M, et al. Longitudinal relations among parental emotional expressivity, children’s regulation, and quality of socioemotional functioning. Developmental Psychology. 2003; 39:3-19.
- Fingerle M, Freytag A, Julius H. Ergebnisse der Resilienzforschung und ihre Implikationen für die (heil)pädagogische Gestaltung von schulischen Lern- und Lebenswelten. Zeitschrift für Heilpädagogik. 1999; 50:302-9.