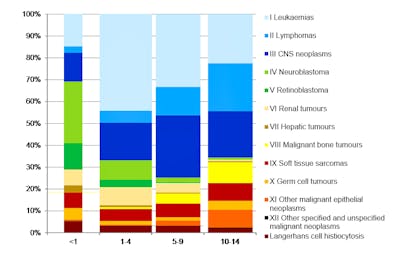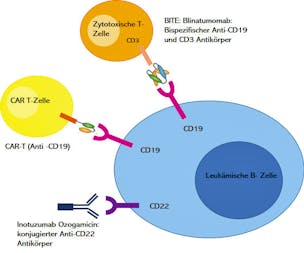Ethische Überlegungen gehören zum pädiatrischen Alltag. Wir stellen hier den Diskurs als mögliches Vorgehen bei der ethischen Analyse eines Falles dar: Eine Mutter mit einer genetischen Mutation des Faktors V (Faktor-V-Leiden-Mutation) wünscht eine entsprechende Abklärung bei ihrem gesunden 3-jährigen Kind. Ein Diskurs basierend auf relevanten klinischen Daten, auf ethischen Fragestellung und auf Distanzfindung / Objektivierung/Einigung erlaubt es, einen Konsens (Information, Überlegungen der Eltern) zu finden und in einem konkreten Fall eine Entscheidung zu treffen, ohne Anspruch auf Allgemeingültigkeit. Dies kennzeichnet ein Behandlungskonzept im einzigartigen Arzt-Patient-Eltern-Verhältnis.
Diskurs in klinischer Ethik, eine Entscheidungshilfe