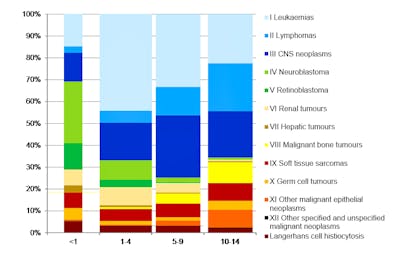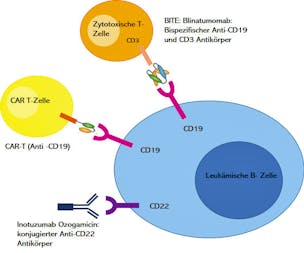Die idiopathische oder immun-thrombozytopenische Purpura (ITP) ist eine Blutungskrankheit mit einer Inzidenz von 1–4:100000 Kindern pro Jahr. Es handelt sich um eine Störung der primären Hämostase mit Thrombozytopenie (Thrombozytenwert <150 x109/L) wegen stark verkürzter Lebensdauer der Thrombozyten, weil die Zellen durch das monozytäre phagozytäre System vorzeitig abgebaut werden. Die Ursachen sind weitgehend unklar und die ITP stellt sozusagen einen Sammeltopf verschiedener Ursachen und pathogenetischer Mechansimen dar. Die Heterogenität der ITP und der Mangel an klinischer Evidenz sind Gründe für die vielen Kontroversen. Die kurze und nicht vollständige Übersicht möchte Aspekte des geschichtlichen Hintergrundes, der Pathophysiologie und der Klinik beleuchten, um die klinische Beurteilung und die Entscheidungsprozesse bei Patienten mit ITP zu fördern.
Die idiopathische thrombozytopenische Purpura im Kindesalter: Fakten und Fragen